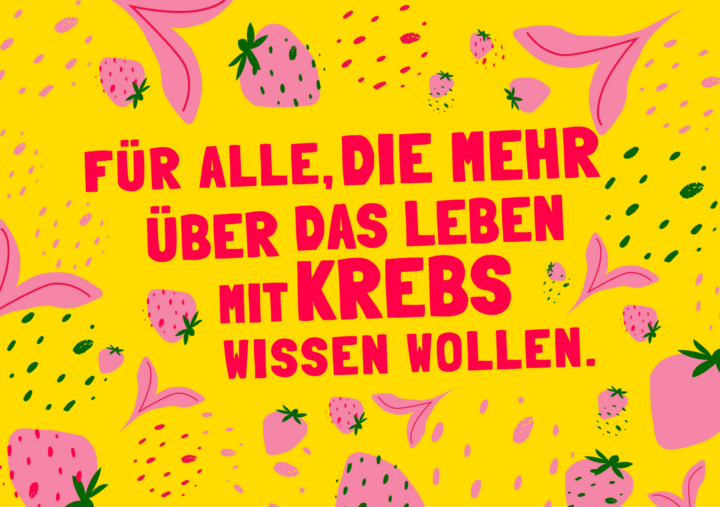Carsten erzählt: Warum Schuld eigentlich eine Sinnfrage ist
Schuldgefühle bei Krebs können echt runterziehen – aber wenn man richtig mit ihnen umgeht, können sie Sinn geben. Unser Psychoonkologe Carsten erzählt von vier Arten der Schuld und wie sie unser Leben beeinflussen.
Darüber plaudert Carsten heute:
- Warum Schuld bei Krankheit viele Gesichter hat.
- Wie das Annehmen von Hilfe Nähe schafft und Sinn stiftet.
- Wie die Schuldfrage sich zur Sinnfrage entwickelt.
Schuld ist ein schwieriges Wort – moralisch aufgeladen, eigentlich immer negativ gemeint, und im Kontext von Krebs ein Thema, das gerade dann runterzieht, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann.
Es gibt da diesen lustigen wissenschaftlichen Begriff der „subjektiven Krankheitstheorie“. Klingt kompliziert, beschreibt aber im Grunde nur die persönlichen Annahmen eines erkrankten Menschen darüber, wie und warum er oder sie erkrankt ist.
So schön neutral die Theorie auch formuliert ist, in der Praxis ist Schuld persönlicher als eine Intimrasur und so rational wie ein besoffener Fußballfan. Aber erfahrungsgemäß lastet sie auf fast jedem und jeder Krebspatient:in, und deswegen will ich heute hier meinen Senf zur Schuld dazugeben, auf dass sie sich für den ein oder anderen besser verdauen lässt.
Ich habe vier verschiedene Formen von Schuld identifiziert. Mit zwei davon bin ich selbst in Berührung gekommen, die anderen zwei tauchen regelmäßig in meiner psychoonkologischen Betreuung auf. Jede:r von uns hat höchstpersönliche Gründe dafür, und doch ist da immer ein gemeinsamer Kern: Die Suche nach Sinn und Bedeutung. Lass mich erklären.
Carstens Psychoonko-Kolumne
Warum ist Carsten Psychoonkologe geworden? Grund war eine hautnahe Krebserfahrung, im zarten Alter von 24. Die Zeit war jedoch nicht nur schwer, sondern auch lehrreich. 14 Jahre nach seiner Diagnose ist er, trotz schlummernder Metastasen, das blühende Leben selbst, läuft Marathons und hilft mit seiner positiven Art und seinem ausschweifenden Wissen jungen wie alten Krebspatient:innen beim psychischen Waschgang.
Jetzt auch in geschriebener Form! Das Kurvenkratzer Magazin präsentiert “Carstens Psychoonko-Kolumne” (inklusive schwarzem Humor und hochdosierter Empathie). Seine ganze krasse Geschichte kannst du hier nachlesen!
1 Die Schuld, ungesund gelebt zu haben
„Ich hätte mich mehr bewegen, gesünder essen, Warnsignale ernster nehmen, früher zum Arzt gehen sollen.” Hätte, hätte, Fahrradkette. Konjunktiv schön und gut, aber die Realität ist komplex: Krankheiten entstehen aus einem Zusammenspiel genetischer Faktoren, Umweltbedingungen, Lebensstilfaktoren und manchmal einfach einer grausamen Laune der Natur. Selbst wenn man alles „richtig“ macht, gibt es keine Garantie, gesund zu bleiben.

Aber das Wissen darum schützt noch längst nicht vor Schuldgefühlen. Ich bin ein großer Fan von Gleichzeitigkeit: In diesem Fall ist es möglich, gleichzeitig zu verstehen, dass man nichts falsch gemacht hat – und sich dennoch schuldig zu fühlen.
2 Die Schuld, etwas falsch gemacht zu haben
Manche interpretieren die Erkrankung als Strafe – sozusagen als „Quittung“ für vergangenes Verhalten oder als Signal einer höheren Macht, am falschen Weg zu sein. Diese Deutungen sind wissenschaftlich unbelegbar, weil sie in 0,0 Prozent Zusammenhang mit der Erkrankung stehen, aber das macht sie für viele Menschen nicht weniger real und bedeutungsvoll.
Selbst wenn man ganz genau wissen sollte, woher der Krebs kommt, beantwortet das noch immer nicht die persönliche Sinnfrage: „Was bedeutet das für mich?“ Ganz beiläufig: Ich habe mir diese Fragen auch gestellt.
Als Menschen genügt uns die Faktenlage nicht. Wir brauchen Bedeutung. Deshalb gibt es Religionen, spirituelle Praktiken, Rituale. Auch wenn viele sich heute von klassischen Religionen abwenden, die existenziellen Fragen bleiben. Ob es eine äußere Erklärung gibt oder nicht, wir suchen trotzdem auch eine innere.
Manche finden Trost in der Vorstellung, die Krankheit sei eine Art Prüfung, ein Wendepunkt oder ein Signal zur Veränderung. Als Psychoonkologe muss ich solche Glaubensmuster ernst nehmen, weil sie auch hilfreich sein können. Nur wenn sie stark belasten oder schädlich wirken, hinterfrage ich sie kritisch. Aber wenn sie zu mehr Achtsamkeit, gesünderem Leben oder innerer Ruhe führen, hat diese Schuldfrage durchaus ihre Daseinsberechtigung.
Innere Ruhe ist auch immer damit verbunden, sich im Hier und Jetzt zu verankern und wieder Stabilität zu erlangen. Wie das gelingen kann? Wir hätten da eine ebenso einfache wie effektive Übung parat.
3 Die Schuld, eine Bürde zu sein
Andere empfinden Schuld, weil sie auf Hilfe angewiesen sind – seien es Fahrten ins Krankenhaus, Unterstützung im Haushalt oder emotionale Begleitung. Manchmal hat man einfach das Gefühl, anderen zur Last zu fallen. Glücklicherweise meist unbegründet, denn was ich oft erlebe, ist, dass Angehörige selbst ein großes Bedürfnis haben, zu helfen.
Sie können vielleicht nicht direkt Schmerzen lindern, aber sie wollen Teil des Prozesses sein. Für sie ist Hilfe eine Form der Verbundenheit, ein Mittel gegen die Ohnmacht gegenüber der Krankheit.
Dahingehend ist gegenseitige Unterstützung ein bewährtes Bindemittel. Wer Hilfe gibt, fühlt sich gebraucht. Wer Hilfe annimmt, erfährt Nähe. So kann die Schuld, eine Bürde zu sein, im besten Fall zu einer gemeinsamen Sinnquelle werden.
4 Die Schuld, überlebt zu haben
Wenn du überlebst, während andere mit ähnlicher Diagnose sterben, kann ein schmerzhaftes Gefühl zurückbleiben – als hätte man etwas bekommen, das einem gar nicht zusteht. Dieses Gefühl ist zwar nicht logisch, aber wie es mit Gefühlen nun mal ist, macht es das nicht weniger real.
Ich spreche da aus eigener Erfahrung und habe gefunden, dass es nicht darum geht, eine Antwort auf die Frage „Warum darf ich leben, während andere sterben?“ zu finden, sondern darum, dieser Frage überhaupt Raum zu geben.
Diese Gedanken sind fast immer mit Trauer verwoben: Trauer um die, die nicht mehr da sind, und um die gemeinsamen Momente, die nicht mehr geteilt werden können.

Wenn es um Schuld geht, glauben wir oft, wir dürfen keine Freude empfinden. „Ich darf das nicht genießen, weil jemand anderes nicht dieses Glück hat.“ Aber wenn du ein Telefon ins Jenseits hättest und den oder die Verstorbene sprechen könntest, würde er oder sie dir zu 100 Prozent sagen: „Ach du. Süß von dir, aber du würdest mir den größten Gefallen tun, wenn du einen großen Schluck Freude trinkst und dein Leben lebst“. So oder so ähnlich.
Also, wieder ganz nach meiner geliebten Gleichzeitigkeit: Beides darf gleichzeitig sein – Trauer und Freude. Trauerarbeit ist nicht eindimensional.
Nein, Trauer ist eher ein Labyrinth, das zu einer versöhnlichen Mitte führt. Das und wie du mit dem Tod von Angehörigen umgehst, haben wir in diesem Artikel festgestellt.
Die Schuldfrage als Tor zur Sinnfrage
So, und jetzt zur Millionenfrage: Wie mit der Schuld umgehen, dass sie einen auf Dauer nicht untertaucht, sondern aufschwimmen lässt?
Der erste Schritt dahin ist oft ein Realitätscheck: die Erkenntnis, dass man nichts am Geschehenen ändern kann und über gewisse Dinge keine Kontrolle hat. Einen Schritt weiter geht es darum, die verbleibenden Gefühle zuzulassen und Wege zu finden, mit ihnen zu leben – etwa durch Bewusstseinsübungen oder offene Gespräche.
Manchmal bleibt das Ergebnis ernüchternd: Es gibt keinen Sinn, zumindest keinen erkennbaren. Der Tod eines Kindes an Krebs ist dafür ein extremes Beispiel – gerade als Eltern emotional kaum auszuhalten. Doch auch hier suchen Menschen nach einem Halt, und oft entsteht er im Tun: im Helfen, im Weitergeben von Kraft, im Teilen von Gefühlen.
Auf psychischer Ebene ist es entscheidend, Schuldgefühle nicht einfach wegzuschieben, sondern ihnen Raum zu geben. Wie bei einer Kunstgalerie, interessiert das abstrakte Gemälde betrachten, bis du hindurchschaust und den Sinn dahinter entdeckst. Ich glaube, dass die Schuldfrage sich, wenn sie Ausdruck bekommt, fast immer in eine Sinnfrage verwandelt. Und wenn das nicht passiert, kann professionelle Hilfe aufzeigen, damit umzugehen.
Denn wenn Schuld lange bleibt, ist es oft ein psychisches Muster, das verankert ist. Aber die typische Schuldfrage lässt sich lösen – durch Raum und Zeit, und nicht durch Wegschieben im Sinne von: „Du hast keine Schuld.“
Quellen & Links:
- Du willst Carsten bewegt und in Farbe? Seine Psychoonko-Kolumne gibt es auch im Reelformat auf unserem Instagram-Kanal.
- Carstens Verein „Jung und Krebs e.V.“ verbindet junge Krebsbetroffene in und um Freiburg.
- Auf seinem Instagram-Kanal spricht Carsten frei über seine Krebserfahrung (und läuft Marathons, als gäbe es kein Morgen).
Titelbild: Britt Schilling/Kurvenkratzer
Über die Serie
Carstens hautnahe Krebserfahrung im zarten Alter von 24 hat ihn zum Meister der krebsverwandten Gefühlswelt gemacht. 14 Jahre nach seiner Diagnose hilft er als Psychoonkologe jungen wie alten Krebspatient:innen beim psychischen Waschgang. Jetzt auch in geschriebener Form! Das Kurvenkratzer Magazin präsentiert “Carstens Psychoonko-Kolumne” (inklusive schwarzem Humor und hochdosierter Empathie).