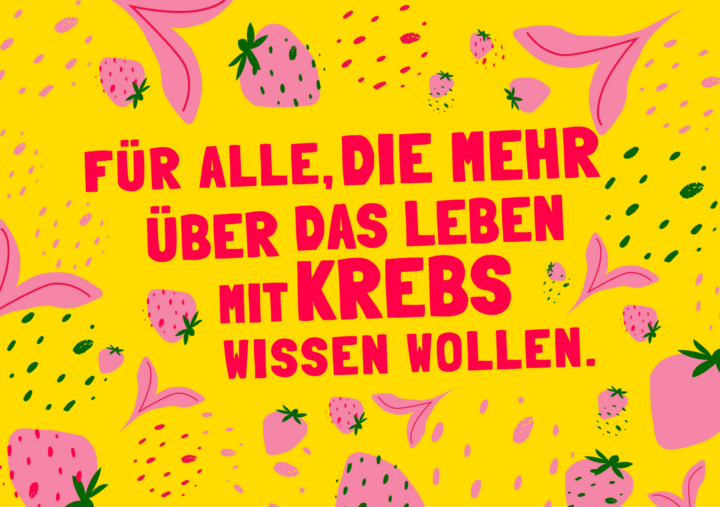So sieht Alex‘ Leben mit Gliom aus
Im Netz findet man zu Gliomen alles außer Klarheit. Die bringen wir. Im Gespräch mit Alex und seiner Partnerin Annika erfahren wir, wie man mit einem Hirntumor weiterlebt, und Prof. Anna Berghoff bringt Licht ins medizinische Dunkel.
Der Artikel passt wie die Faust aufs Auge, wenn du…
- den Unterschied zwischen Gliom und Glioblastom nicht kennst,
- keine Ahnung über das Leben mit Hirntumor hast,
- mehr von einem Betroffenen selbst hören möchtest,
- wissen willst, wie man sich fühlt, wenn der oder die Partner:in an Krebs erkrankt,
- dich dafür interessierst, was Hunderassen mit Gliomen zu tun haben.
Mutationen kennt man sonst nur aus dystopischen Filmen. Leute mutieren zu Zombies mit Heißhunger auf Hirn oder werden zu Schurk:innen mit Laserblick. Bei Alex bedeutet Mutation hingegen: länger leben.
Seine Diagnose? Ein Gliom mit IDH-Mutation. Alex’ Welt steht kurz still. Gerade einmal 31 Jahre alt, sportlich, humorvoll, mitten im Leben. Gemeinsam mit seiner Partnerin Annika erzählt er uns, wie sich ihr Leben verändert hat und was ihnen hilft, jeden Tag neu anzugehen.
Vom Schulkollegen zum Lieblingsmenschen
Aber zurück zum Anfang. Alex und Annika kennen sich eigentlich seit der Schulzeit. Durch den Altersunterschied freunden sich die beiden aber erst später durch den gemeinsamen Freundeskreis an. Gefunkt hat’s dann Jahre später, als beide zum Studieren nach Wien gezogen sind. Bei einem Heimatbesuch in Bayern verabreden sie sich schließlich auf einen Kaffee.

Aus dem Kaffee wurde ein Spritzer (für Leser:innen aus Deutschland: Schorle), aus dem Spritzer wurde Liebe. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Heute ist Annika nicht nur Alex‘ größte Stütze, sondern, wie er witzelt, auch sein wandelnder Terminkalender.
Diagnose Hirntumor – und was jetzt?
Termine hat er einige, denn Alex hat einen Hirntumor. Angefangen hat alles harmlos: Kopfschmerzen, ein nerviges Blitzen im Auge, dazu ein bisschen Vergesslichkeit. Klingt nach Stress, Migräne, oder doch nach einem Burnout – nichts, was einem direkt das Herz in die Hose rutschen lässt. Denn die Symptome lassen sich lang wegerklären. „Ich war in der Arbeit sehr gefordert, deswegen war das auch plausibel“, erinnert sich Alex. Um auf Nummer sicher zu gehen, werden ein Blutbild und eine MRT gemacht.
Wichtig:
Ein Hirntumor ist sehr, sehr selten. Also verfalle nicht in Panik, wenn du mal zwei Tage Kopfschmerzen hast. Beobachte deine Symptome und wende dich im Zweifelsfall an deinen Hausarzt oder deine Hausärztin.
Der Anruf vom Arzt während eines Besuchs in der Heimat reißt Alex aus dem Alltag: Er soll sich sofort in eine Klinik mit neurochirurgischer Abteilung begeben. Da Alex und Annika gerade in Deutschland sind, geht es zuerst nach Regensburg, dann weiter nach München, Verdacht auf Glioblastom.
Glück im Unglück
„In dem Moment war das alles sehr überrumpelnd. Wir haben eigentlich nur funktioniert“, sagt Annika. Es folgt eine notfallmäßige Aufnahme, eine PET-CT, ein schneller OP-Termin. „Ich dachte damals: Shit, wenn der Tumor so groß ist und es ein Glioblastom ist, dann war’s das jetzt“, so Annika.
Sie versucht, ruhig zu bleiben, bis ein Arzt oder eine Ärztin die Diagnose bestätigt oder entschärft. Eine emotionale Achterbahnfahrt beginnt. Kurz danach die erste Erleichterung: Der Tumor ist IDH-mutiert. Eine genetische Veränderung, die den Tumor deutlich langsamer wachsen lässt.

Gliom, Glioblastom – ist doch alles dasselbe, oder?
Im Internet wird da gern beides in einen Topf geworfen, ordentlich umgerührt und mit Panik serviert. Prof. Anna Berghoff, medizinische Onkologin im AKH Wien mit Spezialisierung auf Gehirntumoren, klärt auf: „Ein Gliom mit IDH-Mutation ist kein Glioblastom. Das ist ganz wichtig. Auch wenn sie beide im Kopf entstehen, sind es zwei völlig verschiedene Erkrankungen.“
Wir danken Prof. Anna Berghoff für das Interview und die medizinische Überprüfung des Artikels. Sie ist medizinische Onkologin mit Fokus auf Gehirntumoren. Selbst bezeichnet sie sich als Berufsoptimistin, denn sie liebt die Arbeit mit Krebserfahrenen. Wenn sie gerade nicht Patient:innen begleitet, nimmt sie die Energie oder Emotionen ihres Alltags und trägt diese ins Labor, um zu forschen. Ihr Ziel: das Leben von Patient:innen mit Gehirntumoren zu verlängern und zu verbessern.
Sie vergleicht es so: „Ein IDH-mutiertes Gliom ist wie ein Labrador, ein Glioblastom wie ein Terrier. Beides Hunde, aber komplett unterschiedliche Rassen. Das eine bleibt oft ruhig und träge, das andere ist schnell und aggressiv.“
Die Mutation wirkt dabei wie eine Bremse. Sie verlangsamt das Tumorwachstum und macht den Verlauf kontrollierbarer. Trotzdem ist klar: Auch ein IDH-mutiertes Gliom ist nicht harmlos, aber behandelbar. „Viele dieser Tumoren gehen in eine Art Winterschlaf“, so Prof. Berghoff. „Die sitzen einfach da. Und manchmal bleiben sie da, über Jahre.“
Tumorprofiling:
Tumorprofiling ist die genaue Diagnose oder besser gesagt die Analyse der Gene eines Tumors. Prof. Berghoff erklärt: “Wenn man sich einen Tumor auf einem Bild ansieht, dann kann ein Glioblastom genauso aussehen wie ein IDH-mutiertes Gliom.” Daher braucht man die Information der Gene, die in einer Tumorprobe analysiert werden kann. Wichtig zu beachten: Die Sequenzierung kann dauern – manchmal bis zu sechs Wochen.
Nicht googeln, sondern reden
Auch Alex und Annika haben auf Google verzichtet. Stattdessen haben sie Fragen gestellt, mit den Ärzt:innen gesprochen, eine Zweitmeinung eingeholt. Andere in ihrem Umfeld reagierten ganz anders:„Freund:innen haben gegoogelt und waren völlig aufgelöst. Haben uns angerufen und gesagt: ‚Der stirbt ja jetzt?!‘“, erzählt Annika.
Auch Dr. Berghoff sagt ihren Patient:innen immer: „Googlen Sie nicht die Krankheit, googlen Sie lieber mich, ist viel lustiger.“
Humor als Rettungsanker
Lustig hat es das Pärchen sowieso, denn Positivität bestimmt ihr Wesen. Galgenhumor gehört da einfach dazu. Alex und Annika fokussieren sich auf die schönen Dinge im Leben, die ihnen Kraft geben: der Kuchen, den die Familie vorbeibringt, oder der schöne Abend mit Freund:innen, bei dem die Wangen vor lauter Lachen weh tun.

Aber auch wenn die positive Einstellung da ist, sieht der Alltag nicht immer so rosig aus. Annika hat ihr Studium pausiert, um Alex zu unterstützen. Sie koordiniert Termine, organisiert den Alltag. „Ich schau, dass wir beide fit bleiben. Nicht nur körperlich.“ Trotzdem merkt sie: „Ich funktioniere, wenn’s drauf ankommt. Aber das Verarbeiten kommt dann zeitverzögert.“
Der Alltag hat sich verändert. Weniger Termine, mehr Müdigkeit. „Wir haben uns eine neue Routine aufgebaut: morgens Sport, dann schauen, wie es weitergeht. Struktur hilft.“ Auch Freund:innen und Familie geben Kraft. „Am Ende sind wir immer noch Alex und Annika, die mit Freund:innen Spritzer trinken.“
Belastungsfaktor Krebs
Beide reflektieren viel. Über Veränderungen im Alltag, über das Gefühl, vergesslicher zu werden, und über die Angst. „Ich war sonst immer jemand, auf den man sich verlassen kann“, erinnert sich Alex und Annika ergänzt: „Die Angst ist das, was mir am meisten im Weg steht.“
Was ihnen hilft? Immer miteinander reden. Schließlich sind sie ein Team, mit starken und schwachen Tagen: „Wir besprechen eigentlich alles. Sogar das Unwichtige“, sagt Alex. „Wenn’s wichtig ist, reden wir drüber. Wenn’s nicht wichtig ist, auch. Wir haben ja Zeit.“

Was bleibt?
Heute leben Alex und Annika mit der Diagnose, aber nicht für sie. „Es darf mir schlecht gehen, auch wenn ich gerade nicht in Lebensgefahr bin“, sagt Alex. „Ich bin immer noch ich. Und ich mag mich eigentlich ziemlich gern.“
Als Paar feiern sie kleine Dinge: Sonnenaufgänge. Ein gutes Gespräch. Die Aussicht auf die erste gemeinsame Reise nach Australien. Bald wieder Autofahren zu dürfen. Und vor allem feiern sie einander.
Man muss nicht jeden Tag stark sein. Aber es hilft, wenn man jemanden hat, der einen daran erinnert, dass das Leben trotz allem weitergeht.
Die Produktion dieses Artikels wurde von SERVIER Austria GmbH und SERVIER Deutschland GmbH unterstützt, unter Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit.
Titelbild: Privat